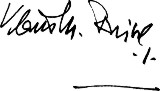ZUM PETER-HUCHEL-PREIS 1991 Robert Wohlleben als Verleger hatte mein Buch »Die Geigerzähler hören auf zu ticken. Neunundneunzig Sonette mit einem Selbstkommentar« mit der Bitte um Rezension an den Südwestfunk Baden-Baden geschickt. Die Redaktion brachte keine Besprechung, sondern teilte mit, sie habe das Buch zu dem mit 15.000 DM dotierten Peter-Huchel-Preis für Lyrik 1991 vorgeschlagen. Selbstverständlichlich wird niemand erwartet haben, die Jury würde mir den Preis zuerkennen. Literaturpreise sollten meines Erachtens per Losentscheid vergeben werden, um allen Kandidaten die gleiche Chance einzuräumen, aber man will im Kulturbetrieb des Als-Ob nicht auf Juroren verzichten, um den Anschein gerechter Urteile auf der Basis von Qualitätskriterien zu wahren. Laut einer dpa-Meldung (veröffentlicht im Tagesspiegel vom 16.1.1991) fiel der diesjährige Peter-Huchel-Preis an Günter Herburger, und zwar für sein Buch »Das brennende Haus. Gedichte« (Frankfurt am Main 1990, Luchterhand Literaturverlag, 141 Seiten; numerierte, teilweise signierte Auflage von 1000 Exemplaren; 28.— DM). * Der Preis sei ihm gegönnt! Die Summe ist nicht zu verachten, und ich bin nicht Pharisäer genug, um nachträglich zu behaupten, ich hätte im Falle des Falles 15.000 DM zurückgewiesen. Gewinnen kann nur Einer. Ob der Beste gewonnen hat, sollten die Leser beurteilen. Ich will meinen Freunden nicht zumuten, Herburgers Gedichtband zu kaufen, und zitiere statt dessen aus meinem Exemplar (es trägt die Nummer 553). Die Lektüre mag nicht zuletzt auch einigen Aufschluß über den Zustand der deutschen Gegenwartslyrik geben. Mein Kind, mein Kind, Diese Schlußstrophe eines als »Lied« betitelten Gedichts scheint mir typisch für den Autor, aber ich bin kein Literaturpapst und kann mich irren. Für eine Stilkritik bietet das Buch kaum Anhaltspunkte, auch wenn die Zeile gleich einer gehabten Erinnerung (S. 108) in mir die gehabte Erinnerung an einen alten Schlager in der gewesenen Interpretation des alten Johannes Heesters wachruft: Der Klang des gespielten Klavieres (oder so ähnlich). Diese Reminiszenz ist keine Wertung, sondern Ausdruck meiner Ratlosigkeit: Wie nähert man sich solchen Gedichten? Wie goutiert man Verse, die sich offenbar zur Gänseblümchenlyrik nicht fügen wollen? Denn: es wüchsen dort schwarze Gänseblümchen, Lyrik ist Wortkunst. Die Sprache ist für alle da. So wird vielleicht der Vergleich des Wortgebrauchs bei Herburger (H.) und Rarisch (R.) in den miteinander konkurrierenden Gedichtbänden hilfreich sein. Ich zitiere geschlossene Sinneinheiten. Nachts ticken rote Zahlen in einer Uhr (H. S. 75) Die Geigerzähler hören auf zu ticken (R. S. 63) Kleine Häuser strebten Sie nah zu sehn, steigt er auf Freiersstelzen (R. S. 96) Tag und Nacht ziehen Flugzeuge Stell uns in deine sicherste Vitrine, noch ein paar Wochen, Es war der Strand, an dem man stranden mußte, Schön ist der Sturm, Auf schroffen Klippen in dem toten Sund ein Igel oder ein Stachelschwein
als Igel unter Igeln eingeigelt – Fliehend duckte ich mich, Ein alter Taschenkrebs wetzt seine Scheren (R. S. 92) im nächsten Augenblick Bei Assel, Tausendfüßler und Skorpion Geister und Eltern, denen ein Kugelblitz
und Pudel, die noch Pudelkerne knacken, Der Kopf der größer gewordenen Kuh Erkannte er, wem da sein Bildnis glich? begierige Chronisten die Dynastie, wie die Chronisten schreiben, 231 Register gleich 17000 Stimmen Verrostete Register schrill durchdringen Delphine verschnellerten den Text der Bibel Beschlaft die Bibel, über Nacht kommt Rat! (R. S. 22) Später stampft er in seine Zimmerhöhle, bis eine Stimme feist zerquatscht den Wahn: Oder besprechen wir Schicht um Schicht, Was tun? Von Satelliten rings umschwirrt … Bevor der Leser zusammenbricht, »weinend erschöpft«, darf – wiederum ohne jede Wertung – festgestellt werden: Trotz zahlreicher Konkordanzen hat der Vergleich nur die absolute Unvergleichbarkeit beider Autoren ergeben. R. reimt; H. nicht. R. bietet feste Metren; H. lockeres, prosanahes Parlando. R. assoziiert stringent; H. reiht Atmosphärilien und Metaphern beliebig aneinander. Es führt kein Weg von R. zu H. oder zurück. Der Preis hätte in der Tat zwischen beiden ausgelost werden können, ohne den Verlierer zu kränken oder den Gewinner zum Genie zu stilisieren. Die Jury-Entscheidung dagegen setzt, zum ixten Mal, das altbekannte literaturpolitische Signal: gegen eine als überholt diffamierte Kleinverlagslyrik, für eine Postmoderne ohne Ecken, Kanten und Widerhaken aus der Buchfabrik. Gegen Sonette – für das Nette! Das Muster findet sich bei H. selbst (S. 44): Derzeit liefen Sprüche um wie: Diese Strophe ist Herburgers Programm. »Wer nicht reimt, pfuscht« gehört zu den »Sprüchen«, die H. nur noch mit überlegenem Grinsen referiert. Es ist ein »Aufschrei« zurückgebliebener Urmenschen aus Moskau, die der zivilisierte Westliterat nur bedauern kann. Der andere Spruch, der von »uns«, von H. und seinen Geistesverwandten, hieß: »Wer strickt, mordet auch« – will sagen: Wer Gedichte nach festen Kompositionsprinzipien »strickt«, wer formt, anstatt zu vomieren, der »mordet auch«, nämlich den naiven Fortschrittsglauben einer heilen Welt der Literatur. Wen wundert es, daß die Jury daraufhin so entschieden hat, wie sie es sich und den tausend Luchterhand-Lesern schuldig war?
|